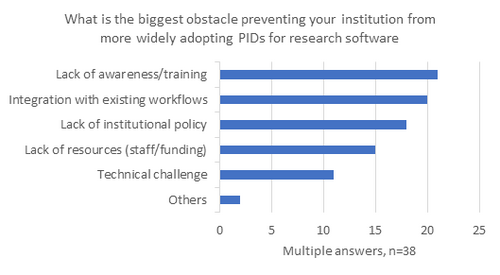Mit der fortschreitenden Digitalisierung in Forschung und Lehre steigt die Zahl der Softwarelösungen an wissenschaftlichen Einrichtungen deutlich. Die zuverlässige Bereitstellung und Nutzung dieser Software ist essenziell, um Forschungsergebnisse nachvollziehbar zu machen und ihre Weiterverwendung zu ermöglichen. Die Anerkennung von Software als wissenschaftliches Produkt ist von entscheidender Bedeutung, um den Impact für Forschung und Innovation sichtbar zu machen und ihre nachhaltige Nutzung sowie Zitation zu fördern. Dabei spielen Persistente Identifikatoren (PIDs) eine zentrale Rolle: Sie gewährleisten eine eindeutige Zuordnung und erleichtern das Auffinden, Zugänglichmachen, die Interoperabilität sowie die Wiederverwendbarkeit von Software im Sinne der FAIR Prinzipien.
Das Projekt "PID Network Deutschland" veranstaltete am 30. Juni 2025 das Online-Seminar "PIDs für Software". Dabei beleuchteten wir verschiedene Aspekte hinsichtlich der Dokumentation und Nutzung von Software. Neben einer Einführung in nationale und internationale Initiativen zum Umgang mit Forschungssoftware, ging es auch um praktische Herausforderungen und Lösungsansätze gehen.
Zu Beginn der Veranstaltung gab es eine Einführung in das Thema „Forschungssoftware” und die Bedeutung von PIDs im Kontext von Software. Alexander Struck von der HU Berlin ordnete die Relevanz für die nationale und internationale Forschungslandschaft ein.
Das Publikationssystem HERMES, vorgestellt durch Stephan Druskat (DLR), wurde für Forschungssoftware entwickelt , um die Veröffentlichung, Dokumentation und Sichtbarkeit von wissenschaftlicher Software zu erleichtern. Es bietet Forschenden eine Plattform, um ihre Softwareprojekte systematisch darzustellen, mit Metadaten zu versehen und dauerhaft zugänglich zu machen. Dabei unterstützt das System auch die Integration von PIDs, um die Software eindeutig zu referenzieren und ihre Zitierfähigkeit zu verbessern.
Morane Gruenpeter (Software Heritage) stellte den Software Hash IDentifier (SWHIDs) vor, der eine dauerhafte und unveränderliche Referenz über den gesamten Lebenszyklus einer Software ermöglicht. So können Software-Versionen, Quellcode und Entwicklungsprozesse zuverlässig miteinander verknüpft werden, um die Nachvollziehbarkeit sowie Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Arbeiten zu sichern. Darüber hinaus beleuchtete Paul Vierkant die Perspektiven aus Sicht des DataProviders DataCite und Esther Scheven (DNB) stellte vor, in wie weit, Softwareprodukte in der Gemeinsamen Normdatei (GND) abgebildet werden können.
In allen Beiträgen wurde deutlich, dass eine Referenzierung von Software mittels PIDs wissenschaftliche Arbeitsprozesse transparenter, vernetzter und effizienter gestalten kann.